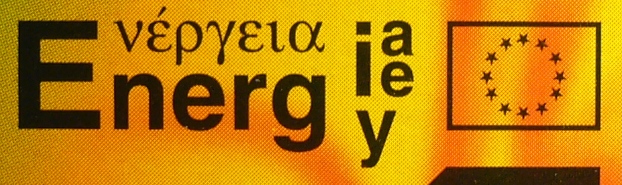Archiv des Autors: Kilian Evang
Vom Heißen
Ein Rant aus dem Jahr 2004
Wenn man Elter wird, sollte man nicht geizig sein und dem Kind schon auch einen zweiten Vornamen geben. Einen zweiten Vornamen kann man im Leben immer gut brauchen: Als Gesprächsthema und Anlass zum Amüsieren in geselliger Runde; als Ausweichmöglichkeit, wenn man das Pech hat, Horst zu heißen; um sich nach dem middle-name-first-street-Prinzip schnell und einfach einen Bühnennamen stricken zu können oder um Briefköpfe, Absenderfelder und Visitenkarten mit einem groovigen, dekorativen Mittel-Initial zu schmücken.
Zweite Vornamen gehören aber nicht auf Geburtsanzeigen, Taufeinladungen und dergleichen! Die freudige Nachricht vom Elternglück im Bekanntenkreis sollte als Erstinformation den Vornamen (und damit meine ich den ersten), den Nachnamen und ein Foto enthalten. Wenn Wert darauf gelegt wird, dürfen auch Audioaufnahmen erster Lebensäußerungen (per E-Mail als MP3-Datei) und die Maße des Bündels dabei sein. Ich will aber nicht mit der ganzen Batterie der Namen konfrontiert werden, die auf dem Standesamt eingetragen werden, später im Ausweis stehen und dem Wohl des Kindes dienen sollen, nicht der Verwirrung der Umwelt. Bei den ganzen Jona Benedicts, Nora Fabiennes und Robert Simeons, die auf einen niederprasseln, wird man ja ganz wirr im Kopf, was soll das?
Ein Vorname pro Name ist für jeden Menschen erst mal gut genug, um durchs Leben zu kommen. Erst auf Anfrage oder bei Bedarf, wie in den oben beschriebenen Fällen, ist der zweite Vorname hervorzuzaubern. Wenn nicht einmal die Eltern selbst sich für einen Haupt-Vornamen entscheiden können und über ihr Kind ständig als Tom Noah reden (wie es der geburtsanzeigengeschädigte Bekanntenkreis ohnehin zunächst einmal tut), wirkt das unbeholfen. Halten sie den ausgesuchten Erstnamen allein nicht für gut genug? Meinen sie, mit zwei Vornamen sei man auch gleich etwas Besseres, wenn sie nur immer schön alle genannt werden? Konnten sie sich nicht auf einen Namen einigen? Oder lässt gar der künstlerische Anspruch der Kombination beider Namen ein Auseinanderreißen nicht zu? Wäre es ein Schlag ins Gesicht des elterlichen Genies, nur einen zu verwenden? Dünkelhaft. Unsouverän. Albern.
Wie aber soll das Kind überhaupt heißen? Im evangelischen, bildungsbürgerlichen Umfeld ist meist etwas Biblisches und etwas etwas Ausgefalleneres dabei. Es muss gar nicht gleich Gerlindis oder Ubbo sein; es reicht schön, aufmerksam möglichst aktuelle Vornamenshitlisten zu studieren und die dort auftauchenden Namen zu meiden. Der männliche Teil meines Jahrgangs zum Beispiel besteht ungefähr zur Hälfte aus Alexanders; so zu heißen, ist die sicherste Methode, um von allen nur mit Nachnamen angeredet zu werden. Vielleicht ist es wichtig, seinen Kindern völlig ausgefallene Namen, die kein Schwein kennt, zu ersparen – viel wichtiger ist es allerdings, ihnen generationsinterne Allerweltsnamen zu ersparen. Natürlich wird man sein Kind auch nicht so nennen wollen, wie die Hälfte all derer heißt, die man selber kennt.
Meine Eltern haben Souveränität bewiesen und mich sehr selbstbewusst einfach Kilian genannt. Einen zweiten Vornamen haben sie mir leider vorenthalten. Ansonsten heiße ich gut – ungewöhnlicher Vorname, noch etwas ungewöhnlicherer Nachname, da fällt es auch nicht so ins Gewicht, dass mir das Mittel-Initial versagt bleibt. Länge und Laut-Buchstaben-Zuordnung meines Namens sind geistesgesund und bewahren mich weitgehend vor endlosem Buchstabieren und Korrigieren. Nur mit der Reihenfolge gibt’s manchmal Probleme, da Kilian vielen nur als Nachname vertraut ist. Muss ich hier auch von Zeit zu Zeit gegen Fehler zu Felde ziehen, so nehme ich dies Schicksal demutsvoll an.
E(νέργεια|nerg(i(a|e)|y)))
Wie geil ist denn bitte diese multilinguale Darstellung des Wortes Energie auf der Verpackung einer Philips-Energiesparlampe?
Man müsste nur ein paar Kreise und Pfeile hinzufügen und hätte eine Darstellung des entsprechenden endlichen Automaten.
Neue Wörter (4)
I·de·oˈlekt <m. 1; Sprachw.> spezifischer Sprachgebrauch der Vertreter einer bestimmten Ideologie
ˈMeh-Efˌfekt <m. 1> das Ausbleiben von Erkenntnis und Begeisterung; Ggs. Aha-Effekt
ˈQuer·kunft <f. 7u> Querkommen; Patrick war mir schon am Morgen quergekommen, am Nachmittag wartete er mit einer weiteren Querkunft auf mich
ˈsu·zen <V. t.> unsicher zwischen vertrauter und formaler Anrede schwanken [Martini]
To-ˈdo-ˌWol·ke <f. 19> über mehrere elektronische Medien verteilte To-do-Liste
ˈvor|krie·gen <V. t.> in den Zustand geraten, etwas vorzuhaben; Ich komme zu der Feier, wenn ich nicht noch etwas anderes vorkriege
ˈZei·chen·girˌlan·de <f. 19> Zeichenkette mit Zeichen aus unterschiedlichen Alphabeten
zerˈwir·kli·chen <V. refl.> sich ~ sich auf der Suche nach Selbstverwirklichung verzetteln und verrennen; Hör mir mit Sharon auf und ihrem Selbstverwirklichungstrip, die wird nicht aufhören, bevor sie sich komplett zerwirklicht hat
Blogspektrogramm #4
 In der letzten Ausgabe des Blogspektrogramms war es recht viel um andere Sprachen gegangen, unter anderem um Lehnwörter, die ihnen das Deutsche verdankt. In den besten deutschsprachigen Sprach-Blogbeiträgen vom Juli 2011 steht die deutsche Sprache in allen Beiträgen im Mittelpunkt – Aspekte ihres Lexikons, ihrer Orthografie, ihrer Flexion, ihrer Morphologie und Probleme geschlechtergerechten Deutschsprechens werden diskutiert.
In der letzten Ausgabe des Blogspektrogramms war es recht viel um andere Sprachen gegangen, unter anderem um Lehnwörter, die ihnen das Deutsche verdankt. In den besten deutschsprachigen Sprach-Blogbeiträgen vom Juli 2011 steht die deutsche Sprache in allen Beiträgen im Mittelpunkt – Aspekte ihres Lexikons, ihrer Orthografie, ihrer Flexion, ihrer Morphologie und Probleme geschlechtergerechten Deutschsprechens werden diskutiert.
Was hat es mit dem Wort Titelhuberei auf sich, das in der Diskussion über Plagiate und Doktortitel plötzlich in aller Munde zu sein schien? Ist es eine neue Schöpfung oder gibt es das Wort schon länger? Wird es häufig gebraucht und wenn ja, wie? Wie ist es zu interpretieren? Anatol Stefanowitsch hat die Korpora, sein Sprachgefühl und seinen analytischen Verstand befragt und gibt im Sprachlog überzeugende Antworten.
Warum schreiben wir <sch> für den Laut [ʃ]? Ich bin sicher nicht der einzige, der sich das immer latent gefragt, aber es nie recherchiert hat. Zum Glück gibt es Kristin Kopf, die das im [ʃplɔk] (wie passend) sehr unterhaltsam erklärt – und plötzlich sieht man, dass unsere merkwürdige Orthografie an dieser Stelle kein Hexenwerk, sondern historisch erklärbar ist.
Dr. Bopp erklärt auf Fragen Sie Dr. Bopp! die Genitiv- und die Pluralform von Euro – und dass beide je nach Laune bzw. Zusammenhang sowohl Euro als auch Euros lauten können.
Viele sprachliche Fragen warf dieses Jahr die Frauen-Fußball-WM auf. Das geht schon mit der Bezeichnung dieser Sportveranstaltung selbst los: Warum sagt man „Frauen-Fußball-WM“, hält es aber bei „Fußball-WMs“ nie für nötig zu erwähnen, dass Männerveranstaltungen gemeint sind? Ist das diskriminierend? Michael Mann gibt im Lexikographieblog eine vorbildlich vorsichtige und differenzierte Einschätzung, beschäftigt sich aber hauptsächlich mit der Frage, wie das Wort Frauenfußballweltmeisterschaft überhaupt aufgebaut ist. Wie man sieht, gibt es mehr als eine Antwort auf diese Frage.
Zweifellos ist die Sprache der Fußballberichterstattung bislang vom Männer-Fußball geprägt. So manche/r hörte dieses Jahr so manche Spielerinnenbezeichnung zum ersten Mal, etwa Torwartin oder Libera. Was Bastian Sick zu all dem zu sagen hat, ist, wie zu erwarten war, großteils haarsträubender Unsinn – Susanne Flach nimmt es auf */ˈdɪːkæf/ auseinander und weist dabei unter anderem auf den von Sick übersehenen Unterschied zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht hin.
Diesen Unterschied führt auch eine Anekdote vor Auge, die ich im Texttheater erzähle. Die Wörter er und sie kommen vor und beziehen sich auf Menschen – ist notwendigerweise von einer männlichen und einer weiblichen Person die Rede? Ich will das Ende nicht verraten, lesen Sie selbst.
Bisher erschienene Ausgaben:
Das Blogspektrogramm #5 wird bei Kristin im [ʃplɔk] erscheinen. Wer auch einen sprachwissenschaftlichen Hintergrund hat und zum Thema Sprache bloggt, erfüllt alle Voraussetzungen, beim Blogspektrogramm mitzumachen, und kann sie kontaktieren, um den eigenen besten Blogbeitrag vom August zu nominieren!
Das jüngste Gewitter
Gutes über hervorragende Filme, Folge 4: Das jüngste Gewitter (Roy Andersson, 2007). Es gibt keine Kamerafahrt in diesem Film und keine Nahaufnahme und nur ausnahmsweise mal einen Wechsel der Einstellung innerhalb einer Szene. Aber was für schön durchkomponierte Bilder die vielen statischen Totalen zeigen! Skandinavisch spartanisch, extrem klar und übersichtlich eingerichtete Räume strukturieren die Bilder mit Türrahmen und Neonleuchten. Der Blick geht stark in die Tiefe, oft in den übernächsten oder sogar überübernächsten Raum hinein. Alles ist gleichmäßig ausgeleuchtet wie von einer Art fluoreszierendem grauen Nebel, der die wenigen sanften Farbflecke wie Möbelstücke, Kleidungsstücke oder das sattgoldene Sousaphon besonders leuchtend hervortreten lässt. Und so leuchtet auch die Hoffnung mit skurrilem Humor aus dem Elend der Menschen hervor, die in dem Film auftreten. Fast alle sind sie ziemlich mitgenommen von Liebeskummer, Geldsorgen, Alpträumen, Alkoholismus, Burnout, dem Diktat des Shareholder Value, der Welt als ganzer. Sie scheitern in den alltäglichsten Situationen. Gezeigt werden gerade die Teile menschlicher Kommunikation, die, weil sie nicht weiterführen, normalerweise nie in Filmen zu sehen sind. So gibt es eine Szene, deren ganzer Dialog wie folgt lautet: „Es ist schon fast halb sechs!“ – „Ja, was soll ich dazu sagen? … Schön, schön!“ Aber es ist keiner dieser Filme, die einen hoffnungslos zurücklassen, im Gegenteil werden viele verschiedene Wege aus dem Unglück gezeigt: Man kann musizieren, träumen, eine Versöhnungsglatze schneiden, sich in den unpassendsten Situationen bei der Kamera oder bei Kunden ausweinen oder notfalls – so entzieht sich ein Unternehmschef dem Diktat des Shareholder Value – einen plötzlichen Herzinfarkt erleiden und sterben.
Hassliebe zu Tübingen
Was Hassliebe zu Tübingen angeht, geht der Trend zur künstlerischen Aufarbeitung:
- Tübingen makes me happy (Blog)
- Tübingen, warum bist du so hügelig? (Musikvideo)
Was ich immer sage (4)
Was bisher geschah: Was ich immer sage, Was ich immer sage (2), Was ich immer sage (3).
- Problem gelöst.
- Daran herrscht kein Mangel.
- Ja, so kann man heißen.
- Stimmt. Stimmt!
- Funktioniert!
- I just made that up.
- Voll gut.
- Discuss.
- Dito.
- Weiß man’s? Will es wer nachprüfen?
- Yeah, well, you know, that’s just, like, your opinion, man.
- I should be writing this down.
- Gut, um Ästhetik geht es also nicht.
- Wollt grad sagen.
- Jesus Christus.
- Oha.
- Warum kam es nicht zum Kuss?
- (als Antwort auf die Frage „Woher weißt du das?“) Osmotisch aufgenommenes popkulturelles Halbwissen.
- Care to elaborate?
- I didn’t mean to imply otherwise.
- And that happens to be a good thing, not a bad one.
- Das hab ich auch schon mal gewusst.
- (als resignativer Kommentar zu manch einem Regelwerk) p∧¬p
- Reaktion wie ein Amboss, nur nicht so schnell.
- Dann waret ooch nit wischtisch.
- Es wird sich nicht vermeiden lassen.
- Two’s a pattern, three’s a paradigm.
- Bummer.
- Vielleicht nicht. (für: Mit absoluter Sicherheit nicht)
- Wiesu denn bluß?
Genus und Sexus
O C., als du, C. und ich neulich durch die Altstadt von Halle an der Saale schlenderten, guckten wir uns an einer großen Gruppe junger Männer erschreckend ähnlichen Phänotyps fest, die Pappschilder mit den Zeichen WILLST DU MICH HEIRATEN? dabeihatten, um sie so in den Himmel zu recken, dass man sie vom Turm der Marktkirche aus lesen konnte. Die Aktion gelang, von oben kam ein positives Signal, es wurde geklatscht und gejubelt. Wohl aus Verachtung für traditionelle Lebensweisen und konventionelle romantische Gesten bemerktest du: Jetzt darf er sie knallen. Und wohl aus Ablehnung von Geschlechterstereotypen und heteronormativen Vorurteilen präzisiertest du rasch und elliptisch: Der Mensch die Person.
Da hat sich die Natur schon was bei gedacht
Frau Schäfer, unsere Biolehrerin, war immer sehr darauf bedacht, dass wir unser Verständnis evolutionärer Mechanismen nicht durch teleologische Metaphern umwölken. Sie verbot uns zu sagen, dass die Giraffe einen langen Hals hat, damit sie Blätter von hohen Bäumen essen kann, nein, der lange Hals hatte einen evolutionären Vorteil dargestellt und sich daher in der Art erhalten. Verständlich, doch mit der Behauptung, teleologische Beschreibungen evolutionärer Vorgänge seien falsch, hatte und habe ich meine Schwierigkeiten – schließlich sind es doch nur Metaphern zur Beschreibung derselben Wirklichkeit.
Den Einwand, in der Evolution spiele Zufall eine viel zu große Rolle, um sich die Kombination aus Mutation und Selektion als planerischen Geist vorzustellen, lasse ich nicht gelten: Unsere Vorstellung von Intelligenz ist ja eine, die auf der Anschauung von Gehirnen basiert, die selbst durch evolutionäre Prozesse zustandegekommen sind und bei denen daher der Zufall jede Chance hatte, Quirks einzubauen, die sich in den Werken dieser Intelligenz fortsetzen.
In diesem Sinne kann man, mit dem gebotenen ironischen Unterton, durchaus ab und zu mal feststellen: Da hat sich die Natur schon was bei gedacht.