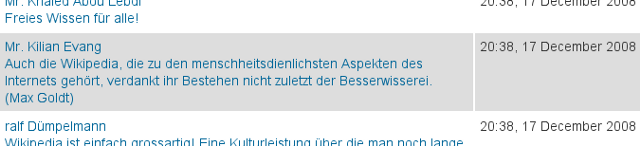Inspiriert durch das bei Max Goldt aufgeschnappte Zitat „Pah, Schauspieler! Fünf Schals, und sie kratzen sich mit der linken Hand am rechten Ohr!“ habe ich mal versucht, dem Ausdruck „LA-DI-DA!“ endlich eine angemessene visuelle Form zu geben.
Archiv der Kategorie: Max Goldt
Die Schrecken der Facebook-Timeline
Wenn Walter Jens Boris Jelzin lila Lutschmobil genannt hätte, dann hätten die Menschen gesagt: »Welch meisterliche Rhetorik!«, wenn ich Jelzin so bezeichnen würde, würde es heißen: »Was für eine skurrile Alltagsbeobachtung!«, und wenn Reinhold Messner über Boris Jelzin gesagt hätte, er wäre ein lila Lutschmobil, hätten alle gerufen: »Was für ein schönes Gebirgsvideo!« Aber wenn Helmut Kohl so etwas sagt, hinterläßt er angeblich einen Scherbenhaufen.
Max Goldt, Warum Dagmar Berghoff so stinkt, Die Kugeln in unseren Köpfen, Haffmans 1995
Und wenn Facebook Boris Jelzin ein lila Lutschmobil nennt (oder die Timeline einführt, oder die Schriftart ändert, oder den Blauton…), sagen alle: „Was für ein dreister Angriff auf meine Privatsphäre!“
Ist „Milf“ etwa ein deiktischer Ausdruck?
Ist Zsá Zsá Inci Bürkles Mutter etwa eine Milf?, fragt sich Max Goldt und bemerkt:
Ich werde das Wort „Milf“, welches akronymischen Charakters ist, hier übrigens nicht genauer erläutern. Dazu bin ich mir zu fein. (…) Am besten, man hat das Wort noch nie gehört. Sagt man nämlich auf einer Party, jedenfalls auf einer soliden Party zu einer Dame: „Sie sind die tollste Milf des ganzen Viertels!“, wird man mit einer klassischen Ohrfeige (…) zu rechnen haben. (…) Übrigens könnte keine Frau, auch die mopsfidelste nicht, von sich selber behaupten, sie wäre eine Milf. Milf und Filf kann man nur in den Augen anderer sein, (…)
Das meint er wohl deswegen, weil mother I’d love to fuck ein I enthält. I (ich) ist ein sogenannter deiktischer Ausdruck. Andere deiktische Ausdrücke sind z.B. du, der da, hier, jetzt. Ihre Bedeutung hängt von der Sprechsituation ab – davon, wo, wann, mit welchen zeigenden Gesten und – in diesem Fall vor allem – von wem sie geäußert werden.
Auf wen sich mother I’d love to fuck beziehen kann, hängt daher auch davon ab, wer diesen Ausdruck benutzt. Denn es möchte ja nicht ein jeder mit denselben Müttern dem Geschlechtlichen frönen: „She’s a mother I’d love to fuck“ – „Well, she’s not a mother I’d love to fuck.“
Ein deiktisches Element – hier ein Personalpronomen – zu enthalten, ist für feststehende Wendungen, wie mother I’d love to fuck eine geworden ist, höchst ungewöhnlich. Mit der Etablierung als Wendung einher ging das häufige Auftreten als Akronym (MILF) und die Wortwerdung: Milf. Die linguistisch interessante Frage ist, inwieweit bei diesem Prozess der deiktische Charakter des Ausdrucks tatsächlich erhalten bleibt.
„She’s a milf.“ – „Well, she’s not a milf.“ In dieser Unterhaltung ist das Wort milf tatsächlich deiktisch, aber sie wirkt nicht gerade natürlich. Sie ist ein Sprachspiel. Und nach dem, was ich über Sprache weiß und intuiere, sind das alle Diskurse, in denen milf deiktisch verwendet wird. Es ist mehr ein Witz als ein Wort, ein Insider für die, die wissen, was sich Ungehöriges hinter der hübschen Silbe verbirgt. Die Schöpfung des Wortes mylf ist eine weitere Runde in diesem Spiel.
Wo milf außerhalb von Sprachspielen benutzt wird, als ganz normales Wort, hat es eine nichtdeiktische Bedeutung angenommen. Wie Max Goldt selbst schreibt, bezieht es sich schlicht auf „attraktive Frauen im Mütteralter“, unabhängig davon, wer es benutzt. So könnte sich durchaus eine Frau selbst als Milf bezeichnen, selbst dann, wenn man von autoerotischen Fantasien als Erklärung absieht.
Während in jeder lebenden Sprache täglich neue Inhaltswörter (Substantive, Verben, Adjektive, Adverbien bzw. entsprechend) geschaffen werden und manche dieser Neologismen sich bald allgemeiner Verwendung erfreuen, ist es so gut wie unmöglich, neue Funktionswörter (Konjunktionen, Präpositionen, Pronomen…) zu etablieren. Ähnliches gilt wohl auch für deiktische Wörter. Ich finde, diese Erkenntnis ist ein interessanter Ausschnitt aus dem Bild „Wie Sprache funktioniert“.
Air Quotes
Anführungszeichen kann man nicht aussprechen. Das ist ein Problem, wenn man Texte mit Anführungszeichen vorliest. Bei Zitaten oder wörtlicher Rede nicht so sehr, da kann man sich die Anführungszeichen aus dem Kontext und der Stimmführung dazudenken. Werden Anführungszeichen aber verwendet, um sich von der benutzten Wortwahl zu distanzieren, um Unglauben oder Ironie auszudrücken, muss man sie irgendwie explizit wahrnehmbar machen. Seriös, aber dem Zuhörer auch leicht entgänglich ist es, vor den angeführten Worten eine hörbare Pause zu machen und sie dann etwas überbetont vorzulesen. So wird es z.B. bei ZEIT Audio gemacht. Max Goldt verwendet auf seinen Lesungen zuweilen die, höhö, Höhö-Methode, höhö, Sie verstehen. Hat man Blickkontakt zum Zuhörer und keine Angst vor dem etwas schlechten Image dieser Geste, wird man dagegen air quotes verwenden.
Bei air quotes hebt man beide Hände auf Kopfhöhe und zuckt – meist zweimal – mit Zeige- und Mittelfingern. Häufiger als beim Vorlesen kommen air quotes als Geste beim mündlichen Kommunizieren zum Einsatz. Über ihre schon recht lange Geschichte verrät die englische Wikipädie mehr.
Wie sollen air quotes eigentlich auf Deutsch heißen? Ich dachte erst an Entenfüßchen wegen Gänsefüßchen und weil sie oben in der Luft sind statt unten auf Papier und Enten ja gründeln – nur: Beim Gründeln bleiben die Füße im Gegensatz zum Bürzel unter Wasser, also stimmt das Bild leider nicht. Vorschläge willkommen.
Mein Schatzkästlein des Humors enthält eine bisher zweiteilige Materialsammlung zum dem Thema: einen Ruthe-Cartoon (Air quotes mit Hufen! Göttlich!) und ein Zitat aus der Simpsons-Folge, in der Bart mit einem Doppelgänger aus reichem Hause die Rollen tauscht:
Lisa: Mom, “Bart” has something to tell you.
Marge: I don’t like the look of those air quotes.
Mein Beitrag zur Wikipedia-Spendenaktion
Das Zitat wollte ich schon lange mal angebracht haben. Leider konnte ich nicht den ganz genauen Wortlaut anbringen, weil ich Max Goldts Verteidigung der Besserwisserei bisher nur von Lesungen kenne.
Ein bisschen Kritik muss bei dieser Gelegenheit aber auch sein: Die Wikipädie könnte so viel mehr sein als eine Enzyklopädie – nicht nur technisch und sozial, sondern auch inhaltlich. Sie sträubt sich aber ein wenig dagegen. In der deutschen Ausgabe stört mich schon lange eine Sorte von Benutzern, die ich gerne die Relevanznazis nenne. Die kennen kein größeres Vergnügen als alles von Admins löschen zu lassen, was nicht „enzyklopädisch relevant“ ist – von Studenten organisierte Fachtagungen etwa. Die englische Wikipädie kam mir da lange viel lockerer vor, aber auch da lese ich in letzter Zeit immer häufiger „This article or section may contain content that is not appropriate for an encyclopedia.“ Ich hege ja Sympathie für die Auffassung, dass Freies Wissen unteilbar ist und dass, wer von Quantendynamik spricht, von recurring characters in vergessenen 80er-Jahre-Sitcoms nicht schweigen sollte. Wird man eines Tages einen Parallelwikikosmos, eine Irrelepedia gründen müssen?
Träume aufschreiben
Ich habe es eine Zeitlang getan,
gesteht Max Goldt in seinem Tagebucheintrag „Daß sich Träume an- und abstellen lassen“ („Wenn man einen weißen Anzug anhat“, Rowohlt 2002),
empfand die aufgeschriebenen Träume beim späteren Lesen aber als albern und ausgedacht klingend und dachte dann, wenn sie eh ausgedacht klingen, braucht man sich nicht schlaftrunken an den Schreibtisch zu zwingen, sondern kann sich im wachen Zustand, wenn man z. B. eh gerade am Schreibtisch sitzt, wirklich welche ausdenken: Ich kletterte auf eine Linde, und oben im Baum saß Frau Borowka, die verhaßte Retusche-Lehrerin aus meiner abgebrochenen Fotografenausbildung. Die gibt mir ein altes Hochzeitsfoto. (…) Das Foto ist natürlich stark bekleckert, denn Retuschelehrerinnen geben einem immer extra bekleckerte Fotos, da man die Kleckse ja wegretuschieren soll (…). Ich steige von der Linde runter, schaue noch einmal hoch und bemerke, daß die Linde gar keine Linde ist, sondern der Zehnmetersprungturm im Freibad von Göttingen-Weende.
Das klingt in der Tat ausgedacht – der Retuschelehrerinnensyllogismus ist viel zu logisch für einen Traum. Was in Träumen als logisch dargestellt wird, sind einem Wachen unergründliche Schlüsse. Und das mit dem Zehnmetersprungturm ist eine schwache Nachmache in Träumen üblicherweise stattfindender Verwandlungen von Personen, Dingen und Orten. Authentischer hätte es geklungen, wenn er von dem Baum schon als von einem Sprungturm heruntergeklettert oder -gesprungen wäre. Die These, dass man sich Träume genausogut ausdenken kann, bricht dann im Folgenden zusammen, als Goldt einen echten Traum schildert:
Ich war in einem Gebäude zugange, das etwas mit einer autoritären Sekte zu tun hatte. Es gab ein Gerücht, daß man irgendwo in dem Gebäude zur Willensbetäubung „besprüht“ wird.
Wunderbar! Exzellent! Das ist typisch Traum! „Gerücht“, das steht gewiss für das diffuse Wissen unbekannter Quelle, das man in Träumen hat, und dann diese originell deplatzierte Terminologie wie „besprüht“! An so was erkennt man Träume! Ein wunderbares Beispiel ist auch Markus Riexingers Text „Ein spannendes Fußballspiel“, der in der Rubrik „Vom Fachmann für Kenner“ in der Titanic veröffentlicht wurde.
Sollte ich einmal den Nerv entwickeln, Beispiele aus der eigenen Erfahrung abzutippen, werden Sie, liebe Leser, davon erfahren.
Heilige Etymogelei
Ein besonders schönes Ziel für Parodien sind Predigten, die mit wackeligen Analogien vom Alltag zu Gott überleiten. In einem katholischen Kirchenblatt las ich mal eine besinnliche Spalte über Sterne am Himmel und Stars im Fernsehen. „Bei all dem Strahlen, das von George Clooney, Madonna oder Drew Barrymore auszugehen scheint“, schloss sie sinngemäß, „sollten wir eines nicht vergessen: Sterne leuchten nicht aus eigener Kraft. Sie reflektieren nur das Licht der Sonne.“ FAIL. So etwas funktioniert nicht nur mit Astronomie, sondern auch mit Fremdsprachen. Hier sind evangelische Pfarrer im Vorteil, sie haben nämlich mitunter Kinder, an denen sie ihre Ausführungen testen können. So konnte ich meinen Vater einmal davor bewahren, The Godfather of Jazz mit Der Gottvater des Jazz zu übersetzen. Andere Pannen sind unsubtiler und passieren auch noch: Ein Pfarrer griff sich aus dem Schatz des Alltags das burn-out-Syndrom heraus und ließ die Gemeinde wissen, dass auch Jesus für uns „ausgeboren“ sei (via belauscht.de). Ich lag unter dem Tisch, als ich das las, stellt sich hier doch nicht nur die Frage nach Hochwürdens Englischwörterbuch, sondern auch die nach seinen Drogen. Der liebste Wonnegraus sind mir aber die vielen kleinen Wortspiele, wenn sie mit einem staatstragendem Ernst gepredigt werden, der verleugnet, dass sie nur Spiele sind. Die verschiedenen Bedeutungen von aufbrechen miteinander zu verquicken, etwa wenn Abraham nach Kanaan aufbricht und in ihm ein Pfropfen aufbricht, ist ja plausibel und geistreich, alles schön und gut. Ich bin kein großer Kirchgänger und weiß nicht, ob es stimmt, aber osmotisch aufgenommenes popkulturelles Halbwissen lässt mich vermuten, dass Pfarrerinnen und Pfarrer solche Muster oft ad absurdum reiten. Da ich gerade kein gutes Beispiel zur Hand habe, denke ich mir ein dämliches aus: „Und plötzlich ver-steht Jakob. Es ist, als hätte Gott einen Schalter umgelegt, etwas in ihm ver-stellt.“ Max Goldt hat dies in dem wunderbaren Text Die Ansprache des Bahnhofsbischofs (Lesungsmitschnitt auf der CD Die Aschenbechergymnastik) minimalistisch parodiert, indem er einen Doppelsinn nicht einmal andeutet, aber trotzdem das Präfix eines Präfixverbs und die Partikel eines Partikelverbs so betont und absetzt, als gäbe es einen: „Auf einem Bahnhof, wo Menschen auf dem Wege sind, wo Menschen an-kommen, vor schwierigen Ent-scheidungen stehen oder gerade Schwieriges ent-schieden haben.“
Komische Sätze
Heute analysieren wir Komik auf Satzebene. Und zwar nehme ich Max Goldts Herausforderung aus dem Text Der Lachmythos und der Mann, der 32 Sachen gesagt hat (Für Nächte am offenen Fenster, Rowohlt 2003, S. 110) an.
Es muß an dieser Stelle unbedingt auf einen großartigen Satz von Robert Löffler hingewiesen werden, der da lautet: „Nun ist es auch schon wieder 167 Jahre her, daß man Marie von Ebner-Eschenbach gebar.“ Als ich diesen Satz das erste Mal las, dachte ich: Wer nicht sofort exakt drei Gründe nennen kann, warum dieser Satz komisch ist, der hat entweder keinen Humor oder keine analytische Erfahrung, vermutlich beides nicht. Ein brillanter Testsatz in der Tat.
Also gut, analysieren wir: Der wesentliche Teil der Komik entsteht durch das Subjekt man, und zwar in drei Schritten:
- Bei Angaben zum Geburtsjahr bekannter Persönlichkeiten ist das Passiv wurde geboren üblich. Dass hier gebären aktiv verwendet wird, trifft einen unerwartet. Es scheint plötzlich nicht mehr um ein trockenes, bibliografisches Datum zu gehen, sondern um den Vorgang der Geburt, der bei der Auseinandersetzung mit einer Dichterin selten im Vordergrund steht – kaum jemand interessiert sich für den ersten Schrei der kleinen Marie.
- Jemanden zu gebären ist der Inbegriff desjenigen, das nur die Mutter tun kann. Das unpersönliche man ist komisch deplatziert.
- Zusätzlich suggeriert man in Bezug auf ein konkretes Ereignis (also zum Beispiel nicht in „Das macht man halt so“, wohl aber in „Man hat mich vertrieben.“) nicht nur mehrere Beteiligte, sondern auch ein geradezu verschwörerisches, planvolles Handeln, als hätte man es ausgeheckt, die große Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach in die Welt zu setzen.
Zusammenfassend: Der Satz vermischt auf ungewohnte Weise die historische Perspektive auf eine Dichterin und das Auf-die-Welt-Bringen eines Babys.
Jetzt will ich noch erklären, warum dieser Lehrerspruch von schulzitate.de komisch ist:
Kinders, wenn Dummheit lange Hälse machte, dann könntet ihr kniend aus der Dachrinne des Kölner Doms saufen!
Dies wäre ja nur eine gewöhnliche Beleidigung des Schemas „Wenn Dummheit X verursachte, gölte für dich Y“, hier etwas beliebig Ausgedachtes für X einsetzen und eine abstruse Konsequenz einer extremen Ausprägung von X für Y. Wäre da nicht in dem Y des Dachrinnensatzes noch ein feiner Zusatz: „kniend“. An der Stärke der Aussage ändert dieses Adverb lächerlich wenig, denn was ist schon die Länge eines Unterschenkels im Vergleich zur Höhe des Kölner Doms? Der Komik des Satzes kommt es aber sehr stark zugute, weil es die absurde Vorstellung einer Welt, in der man erwägt, aus Dachrinnen zu saufen, aufnimmt, und die Frage der dafür geeigneten Körperhaltung anschneidet.
Zum Abschluss lasse ich noch einen komischen Satz als Übung für den/die Leser/in stehen, den ich einmal im britischen Fernsehen aufschnappte. Eine Gouvernante ermahnt ihre Schutzbefohlenen:
Ingredients of apple pies don’t grow on trees.
Models
Models hießen früher Mannequins und hatten keine Namen, waren nicht prominent und wurden nicht in Fernsehshows eingeladen. Weibliche Models veranstalten heute Spendengalen und werden auf Listen wichtiger Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geführt. Bei männlichen Models hat sich nichts geändert.
Max Goldt vermutete einmal, das liege daran, dass Männer nur auf das Aussehen achten: Eine quäkige Stimme oder ein uncharmantes Gebahren würden der Beliebtheit eines weiblichen Models keinen Abbruch tun. Frauen seien anspruchsvoller und daher sei man bei männlichen Models vorsichtiger, sie anders zu präsentieren als durch die Linse einer still camera.
Nö, ich glaube, es liegt am Sexismus: Mit ihrem Aussehen Geld zu verdienen, ist für eine Frau doch ein toller Beruf. Die hat es geschafft, ist schon eine richtige Karrierefrau. Für einen Mann ist so ein kindischer Beruf aber nicht akzeptabel. Ein männliches Model wird als eine Art Gigolo betrachtet. Es kann durchaus mal in einer Talkshow auftreten, wird dann aber eher zwischen einem von Kopf bis Fuß Gepiercten und einem Schnupftuchfetischisten auf der Couch sitzen, nicht zwischen Veronica Ferres und Mick Jagger.