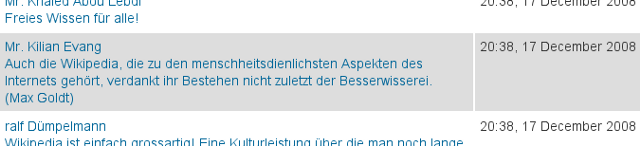Das Urheberrecht ist eine achtenswerte Sache, wiewohl ich glaube, dass die Welt auch ganz ohne es nicht unterginge. Plagiate sind böse, einverstanden. Man merke aber auch: Zitate sind keine Plagiate, sondern legitim. Und in der Literatur müssen Zitate nicht explizit gekennzeichnet sein, zumindest nicht im Text. Sie müssen nur erkennbar sein. Aber Erkennbarkeit hängt natürlich vom Leser ab, deswegen sind solche Zitate von Plagiaten im Zweifel schwer zu unterscheiden.
Der Fall Hegemann bewegt sich offensichtlich in einer Grauzone. Unter den Quellen, die in dem jetzt veröffentlichten sechsseitigen Verzeichnis aufgeführt sind, sind wahrscheinlich beide Sorten von Textübernahmen dabei. Weil es eine Grauzone ist, verstehe ich nicht, wie alle Welt so eindeutige Meinungen dazu haben kann. Eine eindeutige Meinung habe ich in dieser Sache mal wieder hauptsächlich über Leute, die Phrasen wie diese dreschen: „Geistiger Diebstahl ist und bleibt Diebstahl.“ Nein, ist er nicht.
Geistiger Diebstahl ist kein Diebstahl
Ein angeblicher Mörder ist nicht unbedingt ein Mörder. Ein elektrischer Straßenbahnschaffner ist nicht elektrisch. Ein kalter Hund ist kein Hund. Und geistiger Diebstahl ist kein Diebstahl. Ein Diebstahlopfer hat sein Eigentum nicht mehr, ein geistiges Diebstahlopfer sieht sich „nur“ in einem komplizierten Recht auf Selbstbestimmung über das Selbstverfasste verletzt.
Josef Joffe, der uns in der aktuellen Zeit mal wieder einen atemberaubenden Schrott zusammenschreibt, fängt insofern eigentlich ganz vielversprechend an: „Seitdem die Menschheit erzählt, »borgt« und »stiehlt« sie. Aber dann entstand die Idee des »geistigen Eigentums« und des »Plagiats«. (…) Vom 18. Jahrhundert an (…) waren Worte nicht mehr umsonst zu haben; sie gehörten dem Autor, und so entstanden Copyright und Urheberrecht.“
Wir lernen: Das Urheberrecht ist erst kürzlich entstanden, und „entstanden“ bedeutet natürlich: Es wurde von Menschen aus Gründen erfunden und durchgesetzt. Ohne auf diese Gründe irgendwie einzugehen, biegt Joffe, ganz Polemiker, schon im nächsten Satz umstandslos in die kategorische Verteidigung des Urheberrechts ein: „Den Chinesen werfen wir zu Recht das Raubkopieren vor – und Google das Scannen von Millionen von Büchern.“ Zu Recht? Zu welchem Recht?
Und jetzt kommt die entscheidende falsche Behauptung. Sie wird immer wieder gern gemacht, um über die Hintertür des allgemein verbreiteten Respekts vor dem Privateigentum auch die Akzeptanz des Urheberrechts zu steigern. Oder aus Dummheit nachgeplappert: „Worte sind Eigentum – wie Patente und Häuser.“ Nein, sind sie nicht.
Das Eigentum an einem Patent oder einem Haus besteht grob gesagt darin, dass es in den zuständigen Ämtern auf meinen Namen eingetragen ist. Die Tatsache einer solchen Eintragung kann man nicht wie Worte einfach kopieren. Es sind beim Diebstahl wie beim Schutz von Eigentum und geistigem Eigentum völlig verschiedene Vorgänge und Gesetze am Werk, und jeder tut gut daran, auch in seinem persönlichen Rechtsempfinden unterschiedliche Empörungen dafür zu reservieren.
Bei Joffe folgt nun eine Passage, die keinen allzu krassen Unsinn enthält, wenn man davon absieht, dass er Literaturkritikern Vorhaltungen dafür macht, dass sie die Causa unter literarischen Gesichtspunkten bewerten und nicht unter rechtlichen.
Fremde Federn
Was man Hegemann am ehesten vorwerfen kann, bezeichnet Joffe mit „verweislose Aneignung“ sehr gut, wobei ich den Aspekt der Aneignung entscheidend finde. Dass die Verweise fehlen, ist das eine. In der Wissenschaft sind Zitate ohne Verweis per Konvention und sinnvollerweise verboten. In der Kunst ist das nicht so, jedenfalls nicht für mein Kunstempfinden. Viele, die man heute als literarische Größen feiert, wären womöglich nie entdeckt worden, wenn sie so uncool gewesen wären, ihre Textquellen zu listen. Manchmal besteht der literarische Wert einer Übernahme ja auch darin, den Leser die Quelle selbst finden zu lassen. Stichwort Anspielung, Stichwort Verweis, Stichwort Insider, Stichwort soziale Dynamik innerhalb von geistigen Milieus, Stichwort Knuffen in die Seite. Ich benutze variierend auch andauernd Formulierungen, die ich von anderen habe, z.B. Max Goldt, ohne ausdrücklich darauf hinzuweisen. Schon der Übergang zwischen Inspiration und Textübernahme ist fließend. Auf der Ebene kurzer Textfragmente wie Sätzen, Idiomen oder Wörtern ist sogar der Übergang zwischen Textübernahme und ganz normalem Sprachwandel fließend.
Das alles ist eben keine Aneignung. Um statt „Aneignung“ eine Formulierung zu wählen, die ohne Eigentumsmetapher auskommt: Man schmückt sich nicht mit fremdem Federn. Man geht von einer Leserschaft aus, die die Fähigkeit hat, die Quellen zu erkennen, und schmückt sich im Falle von Zitaten nicht mit Worten, sondern mit deren Kenntnis. Nun kann man sagen, Hegemann hätte von keiner Leserschaft ausgehen dürfen, die Airens Blog kennt. Aber es ist nicht klar, ob sie wissen konnte, dass ihr Buch für ein paar Wochen außerhalb der entsprechenden Kreise deutlich bekannter sein würde als Airens Schriften.
Selbst einen Roman, der völlig aus Schnipseln fremder Werke besteht, würde ich nicht als Plagiat bezeichnen, wenn der Autor zwar das Gesamtwerk, nicht aber die einzelnen Schnipsel als seine eigenen ausgibt. Wenn er zu seinen Methoden steht. Es ist der Eindruck entstanden, dass Helene Hegemann nicht zu ihren Methoden stehen, dass sie sie verbergen wollte, bevor die Textübernahmen publik wurden. Wenn das stimmt, ist es wirklich ein Makel. So oder so ist sie mit der Situation nicht gut umgegangen, da stimme ich Joffe sogar mal zu: „Von der Autorin wünscht man sich ein Quantum an Zerknirschung oder, wie es früher hieß: »Wohlanständigkeit«.“
Worte sind kein Eigentum
Wendet sich Joffe nun also der menschlichen Seite zu und ist mit der Zurschaustellung verbreiteter mangelnder juristischer Intelligenz fertig? Leider nein, zwei Sätze später muss ich mir wieder schreiend aufs Hirn greifen: „Sie empfinde es nicht als »geklaut, weil ich ja das ganze Material in einen völlig anderen und eigenen Kontext eingebaut habe«. Ist der Vergaser nicht geklaut, wenn ich ihn in mein Auto einbaue?“ Tja… was soll man dazu noch sagen. Als ich zuletzt nachgeguckt habe, waren zumindest in meinem Exemplar von Strobo alle von Hegemann „geklauten“ Passagen noch vorhanden. Was ich von dem Vergaser, der mir letztes Jahr geklaut wurde, leider nicht behaupten kann. Danke, Herr Joffe, Sie haben gerade selbst demonstriert, wie unsinnig es ist, „geistiges Eigentum“ wörtlich zu interpretieren.
Doch Joffe lässt sich ja von niemandem belehren, auch nicht von sich selbst: „Warum dann zwischen geistigem und materiellem Eigentum unterscheiden? (…) Die Trennung lässt sich nicht durchhalten, nicht in einer Welt, in der die Leistung einer Wirtschaft nur noch zu zwanzig Prozent aus »Dingen« – Autos, Äpfeln, iPods – besteht. Die anderen achtzig Prozent im weitesten Sinne »geistiges Eigentum« sind, die Hauptwertschöpfer des 21. Jahrhunderts.“ Mich würde interessieren, woher er diese Zahlen hat und ob er, bevor er diese Tatsache auf dem Altar der Polemik opferte, wenigstens daran gedacht hat, dass die „zwanzig Prozent“ aus der Übertragung von Eigentum bestehen, die „achtzig Prozent“ hingegen ganz bestimmt ganz überwiegend aus der Gewährung von Nutzungsrechten an geistigem Material. Auch wenn ein Patent verkauft wird, wird nicht die Idee verkauft – die ist vor wie nach dem Kauf in beiden Köpfen – sondern ein exklusives Nutzungsrecht. Entsprechend lassen sich auch keine Worte besitzen, sondern höchstens das Recht, bestimmte Kombinationen von Worten in bestimmter Weise öffentlich zu verwenden. Wenn die Hauptwertschöpfer des 21. Jahrhunderts tatsächlich geistiger Natur sind, ist es umso wichtiger, den Unterschied zwischen Eigentumsrecht und Urheberrecht zu kennen.
Und andere Unterschiede auch, wie den zwischen Urheberrecht und Copyright, auf den ich hier jetzt mal nicht eingegangen bin.