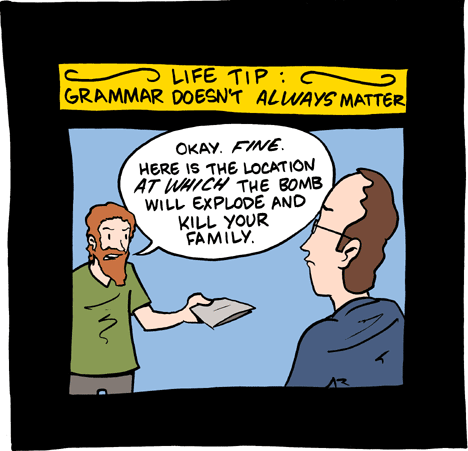Phrasisch ist gar nicht so schwer zu verstehen, liebe Kinder, passt mal auf: Ein Buch wird mir als konsequente Fortsetzung eines beliebten Klassikers angepriesen – da ist klar, es handelt sich um einen billigen Abklatsch. Es sei unentbehrlich, heißt es, sowohl für leichte Partyunterhaltung als auch für seriöse Information. Das heißt: Es kann möglicherweise dazu beitragen. Ein andermal lese ich, dass ein Theaterstück sich jeder narrativen oder logischen Auflösung verweigert. Aha, da ist mit chaotischen Szenen zu rechnen, die am Ende auf nichts hinauslaufen! Die taz bezeichnet die Antiquitätenshow „lieb & teuer“ als einen Seismografen der Krise des deutschen Bildungsbürgertums. Gemeint ist natürlich, dass die Sendung ein gutes Beispiel für diese Krise abgibt, weiter nichts. Schließlich die Amazon-Kurzbeschreibung, die uns mitteilt, Franz Kafka habe die Physiognomie des 20. Jahrhunderts entworfen. Das, liebe Kinder, bedeutet – überhaupt nichts. Es ist ein Füllwort, das im Deutschen unübersetzt bleibt.
Archiv der Kategorie: Sprache
Der Grund, warum
Und ich hatte schon gedacht, auf Englisch würde sich niemand darüber aufregen. Anscheinend gibt es aber doch Leute, die das stört:
Der Mann im grünen T-Shirt hatte vorher wohl „the location where“ gesagt – eine unschöne Dopplung, weil sowohl in location als auch in where steckt, dass es um einen Ort geht. In dieselbe Kategorie gehören „the reason why“, „the time when“ und, etwas entfernter, „just because … doesn’t mean …“ wie in Homer Simpsons sehr schönem Sinnspruch „Just because I don’t care doesn’t mean I don’t understand.“ Ich wage mal zu behaupten, dass all diese Wendungen weit weiter verbreitet sind als ihre „richtigen“ Pendants „the reason for which“, „the time at which“ und „that … doesn’t mean“.
Und wenn Sprache logisch wäre, wäre ich arbeitslos.
Trotzdem tue ich hiermit kund, dass es mich im Deutschen zwiebelt, wenn es heißt „der Ort, wo“ statt „der Ort, an dem“, „die Zeit, als“ statt „die Zeit, zu der“ oder – am schlimmsten und verbreitetsten! – „der Grund, warum“ statt „der Grund, aus dem“. Schätze, ich schätze die Vielfalt und Willkür der von den einzelnen Substantiven regierten Präpositionen zu sehr.
Auch die because–mean-Dopplung hat ein unschönes Pendant (wenn auch kein Äquivalent) im Deutschen: „Nur weil es mir egal ist, heißt das noch lange nicht, dass ich es nicht verstehe.“ Dieser Satz könnte jetzt theoretisch als Leserkommentar folgen.
Was man nicht sagt (2) – Wörter der Empörungsindustrie
Was bisher geschah: Was man nicht sagt
Als Sprachwissenschaftler muss ich meine Sprachkritik ja irgendwie verbrämen, damit ich mir nicht vorwerfen muss, ganz unwissenschaftlich den Leuten vorschreiben zu wollen, wie sie gefälligst nicht zu reden haben. Als Computerlinguist stehen mir da zusätzliche Summwörter zum Verbrämen zur Verfügung, stellen wir das Folgende also unter die Überschrift:
Bullshit Mining
Soll heißen: Sollte jemand einmal ein Programm entwickeln wollen, das Texte analysiert und die Stellen markiert, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit Scheiße gelabert wird, könnte sich dieses unter anderem auf die Wortliste stützen, die ich in diesem und folgenden Beiträgen zusammenzutragen gedenke. Heute geht es um Wörter und Multiwörter, die in der Empörungsindustrie Verwendung finden – da, wo sich über abweichende Meinungen und Geschmäcker echauffiert wird, als handele es sich um Kapitalverbrechen.
„Dieser Film ist eine Schande für die gesamte französische Filmindustrie!“, sagte laut Max Goldt mal jemand über Die fabelhafte Welt der Amélie. Die Meinung allein verrät schon Hartherzigkeit, und dann erst die Ausdrucksweise! Wie schon bei meinen Ausführungen zu dem Wort Kinderschänder geoffenbart, habe ich für Wertesysteme, in denen die böse Tat eines Menschen unter dem Label „Schande“ an einem anderen Menschen klebenbleibt, nun ja… sehr wenig übrig. Ebenso wenig für sprachliche Relikte dieser Wertesysteme.
„Das ist geschmacklos!“ Das Wort Geschmack bezeichnet individuelle ästhetische Präferenzen, oder? In der daraus abzuleitenden Bedeutung „ästhetisch völlig indifferent“ wird geschmacklos aber nie verwendet, sondern im harmloseren Fall um für schlechter erachtete ästhetische Präferenzen abzuurteilen. Das kann ich noch akzeptieren, denn auch ich gebe mich lustvoll der Hybris hin, meinen Geschmack für besser als den vieler zu halten. Mit dem Wort geschmacklos gehe ich trotzdem sehr vorsichtig um, weil es Objektivität suggeriert, als gäbe es da eine gemeinhin akzeptierte Geschmackslehre, anhand derer sich alles testen ließe. Warum nicht das Kind bei einem subjektiven Namen nennen und hässlich sagen? Es muss schon um eine sehr spezielle Art von Hässlichkeit gehen, etwa die einer mit pinken und roten Kätzchen und Herzen gemusterten Tapete, bevor ich das Wort geschmacklos verwenden würde.
Das war jetzt aber nur Vorgeplänkel, denn es geht ja um die Empörungsindustrie. (Industrie, weil Gewinnabsicht: Zur Empörungsindustrie gehört jeder, der mit Empörung Wählerstimmen, Auflage oder Internetdiskussionen gewinnen will. Für den folgenden Punkt ist es nämlich wichtig, Internetforennutzer mithineindefiniert zu haben.) Die benutzt das Wort geschmacklos, wenn es um Witze und Vergleiche geht, die man nicht machen darf, weil man damit Empfindlichkeiten verletzt (hat immer irgendwas mit Hitler zu tun). Es geht dann also nicht um eine ästhetische, sondern um eine moralische Frage. Und da ist das Wort geschmacklos ob seiner Schwammigkeit noch viel weniger geeignet: Es ist eine Totschlagvokabel, die von der Suche nach dem wahren Problem ablenken soll – in vielen Fällen ist das wahre Problem nämlich Dummheit oder unangebrachte Dünnfelligkeit des Beleidigten.
„Das ist nicht witzig!“ Wird auf „geschmacklose“ (s.o.) Witze angewandt, als hätte die politische Korrektheit irgendeinen Einfluss auf die Witzigkeit. Wenn jemand einen anderen Humor hat oder bei heiklen Themen so leicht Klöße im Hals bekommt, dass das Lachen steckenbleibt, ist das was anderes. Bei allen anderen wird höchstens aus „Hahaha“ „Hohoho“ oder „Huhuhu“, aber das Zwerchfell spannt nicht minder.
Semantik
Lieblingswörter (2)
Was bisher geschah: Schöne Wörter, Lieblingswörter.
Die Künste, bei denen es nicht ums Geldverdienen ging – also alles außer Arzt, Anwalt und Banker Pfarrer – wohnten früher in einem Baum mit sieben Blättern und zwei internen Knoten. Einer dieser Knoten hieß „Quadrivium“, weil er vier Kinder hatte, nämlich die Arithmetik, die Musik, die Geometrie und die Astronomie. Bevor man allerdings in diesen Wissenschaften reüssieren konnte, musste man sich in Grammatik, Rhetorik und Logik schulen, dies waren die anderen drei Künste, Kinder des „Triviums“, des propädeutischen Knotens. Daher kommt der Begriff trivial, heute ein Etikett, das in der Wissenschaft mit ziemlicher Beliebigkeit allem aufgeklebt wird, womit man sich jetzt nicht aufhalten möchte, was aber auch hartnäckigem Ausrechnen, Herausfinden oder Reproduzieren keine größen Probleme bereiten sollte. Von dort aus ist das Wort in die Umgangssprache gewandert, wo es nichts anderes als „einfach“ bedeutet. Man füge eine jargonesque Steigerung hinzu und erhält ultratrivial, ein Wort, das ich aufgrund dieser Herkunft ziemlich cool finde.
Auch meine drei neuen Lieblingswörter aus dem Englischen sind in der Wissenschaft heimisch und lustig: strangelet, subformulahood (die Eigenschaft, eine Teilformel zu sein) sowie allowable, das auf dichtestem Raum zwei sehr ähnliche Modalitäten – die es Dürfens und die des Könnens – unterbringt, ohne von sonstiger Bedeutung zusammengehalten zu werden.
Aus der Rubrik „veraltendes Wortgut und allein schon deshalb schön“ haben wir diesmal alleweil, das sich wunderbar für Klagen über Nervereien ohne Ende eignet. Auch tunlichst ist schön emotional, intensiver kann man kaum warnen als mit diesem Adverb. Die Wörter wälzen und klobig bringen klanglich sehr schön Sperrigkeit zum Ausdruck.
Schließlich noch zwei Vertreter der Königsklasse der schönen Wörter: Wörter, bei denen es einfach schön ist, dass es für so eine spezielle Bedeutung ein eigenes Wort gibt. Wörter, die es immer wieder ermöglichen, einen Sachverhalt treffend zu bezeichnen, den man sonst im Schwammigen belassen oder aufwändig umschreiben müsste. Muße ist so ein Wort, das nicht nur die für manche Erledigungen nötige äußere Ruhe einfängt, also die freie Zeit, die bloße Abwesenheit von Terminen und Störungen, sondern auch die oft viel bitterer nötige innere Ruhe, den Zustand, in dem sich die Musen an einen heranwagen. Und das Verb kokettieren ist schön; es bedeutet heute oft ein Spiel mit Gedanken und Meinungen, die man normalerweise ablehnen würde, die aber doch irgendwie einen Appeal ausüben. Kokettieren kann man zum Beispiel mit einem Alkoholproblem oder mit der schönen Gestaltung einer Nazizeitung. In beiden Fällen kann das Kokettieren im Scherz störende Krusten aus Verdrängung oder überflüssiger political correctness aufbrechen helfen.
On Diversity
Arguing for diversity is a tricky business. In my view, the main difficulty is to distinguish between a) why diversity is good in the first place, and b) why it would be bad to lose existing diversity.
In his book Language Death, linguist David Crystal argues for preserving the diversity of the languages of the world, exceptionally many of which are threatened by extinction nowadays. The second chapter presents five answers to the question “Why should we care?”, the first answer being “Because we need diversity.” Unfortunately, Crystal fails to draw aforementioned distinction. Supposedly, he counters the view according to which mankind would be better off with a single universal language, or as few different languages as possible. Actually, he almost exclusively lists difficulties we would encounter in going the way to a monolingual planet – such as loss of profits for companies whose employees stop to learn foreign languages, or loss of cultural heritage because we wouldn’t be able to understand existing documents any longer. After a few pages, both Crystal’s argument and my patience were in shambles to an extent where I had to take a break and blog my five cents about cultural and linguistic diversity.
The way I think about language, the ability to develop and use it is innate to humans and can’t be taken away from us. It is, in other words, nothing we need to worry about in the context of language death. What is endangered is particular shapes in which our faculty of speech manifests itself, shapes that, for all we can say, will not cease to come into existence, change, and become extinct for as long as mankind will exist. The human facility of speech is like an ingenious algorithm running for eternity, generating a new unique fractal of stunning complexity and beauty every few seconds. While it is understandable that one might want to preserve all of those images, most people will certainly agree that the real value is in the algorithm and not any one of its infinitely many outputs. Likewise, for me, no particular language has any value in itself.
This is immediately relativized by the fact that particular languages are closely tied to particular cultures and human achievements, where I do see value, a lot of value indeed. The language that people speak is part of their identity, it is inextricably linked to their lives, their backgrounds, their social relations, their thoughts, their experiences, their emotions, their achievements, all of which I will subsume under the term culture from now on. One can’t take away people’s language without seriously endangering or damaging people’s culture. Even independently of their speakers, languages receive significance by virtue of being the medium of culture. For example, any philosophy, story, or useful recipe written down or recorded on tape is lost to mankind as soon as the respective language is no longer understood.
But both of these points are in the b) line of the distinction I’m insisting upon here! They are interesting only because we already live in a world with many, many languages. They do nothing to make the “one world, one language” utopia a dystopia. Wouldn’t it be great to live in a world where everybody had spoken the same language from the very beginning? A world without God’s punishment for building the Tower of Babel? Shouldn’t we strive towards tearing down all linguistic barriers, translating all of our cultural heritage into one single language and make that language the new world language, for every new citizen of the Earth to learn as their first language?
A true universal language, used not just as a lingua franca, but by everyone in all or nearly all situations, would certainly simplify a lot of matters. Matters of international communication, matters of preserving and making available information. Sure, the loss of diversity would be deplorable from an intellectual point of view: No more fascinating foreign languages to learn, to study, no more strange counterintuitive grammatical constructions to marvel at. The professions of translation and – to an extent – linguistics would be no more. But this would only take away a certain type of intellectual stimulus from certain language geeks like me, a fetish if you will. The loss would be in the domain of self-sufficient punditry (intellektuelles Gewichse, to put it drastically in German), which shouldn’t stand in the way of progress.
However, I don’t think this would work in the long run. I believe that cultural diversity leads to linguistic diversity, thus linguistic diversity cannot be eliminated except in an inhuman dicatorship. Unless you steal people the freedom they deserve, they will express their individuality, leading to cultural diversity, leading, since people invariably choose language as one means of expressing cultural identity, to linguistic diversity.
I have argued that linguistic diversity is a necessary consequence of cultural diversity, which in turn is a necessary consequence of people being people. I will now finally try to answer the question: Does linguistic diversity have any value of its own? Apart from the intellectual value, the pet of the self-sufficient punditry I mocked above, corresponding to the beauty of fractals, the value that in my view is not a real value at all?
Yes, I think it does. People wouldn’t strive for linguistic diversity if linguistic diversity didn’t do anything for them. The same thing is true for cultural diversity, in which case the desire for individuality and identity obviously play their parts. In linguistic as well as in cultural as well as in biological evolution, most things that persist have a function.
For one thing, linguistic as well as cultural diversity has an educational value. The existence of many different languages and cultures allows for studying them, observing their structures, commonalities and differences, and getting a better understanding of how they work. Diversity helps us to put our prejudices into perspective, to see that one culture or language isn’t “better” or “worse” than another. This is true for some anglocentric American who has almost no contact with foreign languages as well as for the African taxi driver cited in David Crystal’s book, who can communicate in all of the eleven languages of his country but doesn’t value this ability because he deems all of those languages inferior. Yet in a sense the educational value of diversity is merely the solution to a problem that wouldn’t exist without it: In a world without diversity, there wouldn’t be any need to fight prejudice.
Thus, in my view, the strongest argument that can be made for diversity a priori is its protective value. David Crystal’s book reports a point made by Peter Trudgill, namely “that languages as partial barriers to communication are actually a good thing, ecologically speaking, because they make it more difficult for dominant cultures to penetrate smaller ones.” This is a point for linguistic diversity under the premise that cultural diversity is good. Similarly, as a point for cultural diversity, there are cultural barriers, preventing memes from spreading uncontrolledly. Imagine what would happen if the meme “torture is a good thing” gained momentum on a planet with just one culture! Luckily, people from one culture are not too likely to pick up memes from another.
Of course we don’t want those barriers too strong, but sometimes it is good to reinforce them a little. This is when programmes for fostering diversity are called for. A biological analogy is obvious; it involves bark beetles and the hard time they have invading mixed forests whereas monocultures are an easy prey. As another example involving linguistic barriers, consider the burning of Danish flags in the Arab world after those Muhammad cartoons were published. Imagine how much more of that shit we would see in the hypothetical and impossible many-cultures-one-language world.
All of that is relative, mind you. Of course an individual can belong to many different cultures, and even the “belong to a culture” notion isn’t black-and-white but comes in a million degrees and variations. Those partial barriers aren’t walls and constitute no fundamental obstacle to Free Flow of Information, of which I am a fan (remind me to create a Facebook page). I hope I haven’t oversimplified too much – I just wanted to get those points out of my head so I can continue reading that book, hoping it gets better.
Ersatzinfinitiv, Bewegung, Koordination
Beim Schreiben meines Auslandssemestererfahrungsberichts für meinen Sponsor, die Landesstiftung Baden-Württemberg, stolperte ich heute, als ich versuchte, in einem Verbletztsatz einen Ersatzinfinitv (müssen) und ein normales Partizip II (gelinst) zu koordinieren. Letzteres sehen wir in (1) in natürlicher Umgebung, einem normalen Verbletztsatz. Das Perfekt des Modalverbs müssen wird nicht mit normalem Partizip II, sondern mit Ersatzinfinitv gebildet, wie wir in (2) sehen. Allerdings will zumindest mein Sprachgefühl, dass das Hilfsverb hätte sich dann an den Anfang des Verbalkomplexes bewegt (3). Dasselbe mit (1) zu machen ergibt allerdings Murx, jedenfalls im Hochdeutschen (4). Im einen Fall muss hätte sich also bewegen, im anderen darf es nicht. Wenn man jetzt die beiden Phrasen mit den Master-1-Kursen vorlieb nehmen müssen und möglicherweise neidisch über den Rhein gelinst mit und koordiniert, führt das zum Konflikt. Bewegt man hätte nicht, klingt es für mich komisch (5). Bewegt man es, klingt es sehr komisch (6). Ein unauflösbares Dilemma? Ich bin ihm ausgewichen, indem ich den Satz zu einem Verbzweitsatz umbaute (7).
(1) dass ich möglicherweise neidisch über den Rhein gelinst hätte
(2) ?? dass ich mit den Master-1-Kursen vorlieb nehmen müssen hätte
(3) dass ich mit den Master-1-Kursen hätte vorlieb nehmen müssen
(4) * dass ich möglicherweise neidisch hätte über den Rhein gelinst
(5) ? dass ich mit den Master-1-Kursen vorlieb nehmen müssen und möglicherweise
neidisch über den Rhein gelinst hätte
(6) ?? dass ich mit den Master-1-Kursen hätte vorlieb nehmen müssen und
möglicherweise neidisch über den Rhein gelinst
(7) ich hätte mit den Master-1-Kursen vorlieb nehmen müssen und
möglicherweise neidisch über den Rhein gelinst
Weg allen Fruchtfleisches
Den mussten gestern Abend meine gesamten Apfelsinenvorräte gehen, weil ich keine Tüten mehr hatte, um sie zu Reiseproviant zu machen. Bisher spüre ich noch keine Anzeichen eines Vitamin-C-Schocks. Erster!
Plötzlich transitiv
gegangen werden ist des Übertreibers Wort der Woche, dazu habe ich noch was im Nähkästchen.
Es ist ein bekannter Witz: Deutsche Verben, die ihr Perfekt mit dem Hilfsverb sein bilden, zuvörderst Verben der Bewegung, zuvörderst Verben der Wegbewegung, werden wider die Regeln des Standarddeutschen transitiv gebraucht, als Kausativ zu ihrer intransitiven Variante: „Ich dachte, du wärst abgereist worden“, flachst Frank in Wolfgang Hohlbeins Spiegelzeit, „Die ist gegangen worden“, „Der ist zurückgetreten worden“, hört man alleweil, „Queen Elizabeth ist dann ja auch gestorben… gestorben worden…“, sinnierte der Lehrer in meinem Geschi-Strafkurs einst. Der Witz funktioniert so gut, weil das Hilfsverb werden sein Perfekt auch mit sein bildet und man nur ein worden an den Verbalkomplex anzuhängen braucht, um den Sinn des Satzes für den Hörer unerwartet zu ändern. Verstohlen und augenzwinkernd zuzugeben, dass Unfreiwilligkeit im Spiel war.
Nicht immer ist die Transitivierung ein Witz: Das Verb trocknen zum Beispiel funktioniert wirklich so. „Die Wäsche ist getrocknet“ kann man genau so gut sagen wie „Die Wäsche ist getrocknet worden.“ Neuerdings gilt das anscheinend auch für umziehen: „Im Lauf des Juli konnte die Wörterbuchsoftware schrittweise auf ihre neue Heimat umgezogen werden“, meldete LEO neulich. Auch dem intransitiven auf etwas stoßen (etwas zufällig entdecken) hat sich ziemlich unbezweifelt ein transitives jemanden auf etwas stoßen (jemandem etwas zeigen) beigesellt.
Nun zurück zu kreativen Neubildungen. „Klasse Idee! Wie ist dir das nur wieder eingefallen?“ Ein bescheidener Mensch könnte darauf antworten: „Eigentlich ist es mir von meinen Freunden eingefallen worden.“ Ein trefflicherer Kausativ wäre hier eingefällt, weil es zu fallen ja schon fällen gibt, aber gut. Oder hier, man stelle sich diese Szene vor: Geheimrat von Fontheweg betrat mein Büro. Seine Fliege saß schief, seine Hose war dreckig, sein Haar wirr und sein Gesicht leicht zerschrammt. Er keuchte vor atemloser Entrüstung. „Sie werden es nicht glauben, mein Freund!“, rief er aus, „Soeben bin ich auf dem Gang hinterhältig gestolpert worden!“ In beiden Fällen lassen adverbiale Ergänzungen – von meinen Freunden, hinterhältig – schon vor der Zeit vermuten, dass ein worden folgen wird, doch witzig ist es immer noch. Sind Sprachspiele ja immer.
An Wörter glauben?
Menschen glauben an Wörter. Und dieser Glaube wird oft ausgenützt. Die Wortakrobaten jonglieren mit ihren Begriffskonstruktionen und machen die Leute glauben, daß sie von Tatsachen reden und Wahrheiten zum Besten geben. Aber nur mit ein wenig sprachkritischer Logik läßt sich feststellen, daß in den meisten Fällen nur geschickt anderweitige Interessen verborgen oder inhaltsleere Worthülsen gehandelt werden. Mit Pauschalisierungen und anderen Verallgemeinerungen werden Vereinheitlichungen postuliert, um ordnungspolitischen Zwecken besser zu genügen. Die Harmonisierung der breiten Masse erfolgt über sprachliche Verallgemeinerungen.
Dem Illusionismus der sprachlichen Abstraktionen, wie er über die Medien transportiert wird, erliegen besonders Menschen mit ungenügender Bildung. Einfache Menschen wollen und müssen an die Worte glauben und den Sprechern vertrauen können, um nicht die essentielle Basis gesellschaftlichen Verkehrs zu gefährden.
Diese Passage sagt mir zwar etwas, ist mir aber zu wenig konkret. Was ist die „essentielle Basis gesellschaftlichen Verkehrs“? Mit dieser Frage verbunden ist etwas, das ich mich schon lange frage: Glaubt Lieschen Chantal Müller zum Beispiel das, was in der Bildzeitung steht? Oder liest sie sie nur zur Unterhaltung, mit einer Abgeklärtheit, die Menschen mit „genügender“ Bildung beim jubeljährlichen Durchblättern mit Einmalhandschuhen abgeht? Eigentlich müsste ich Chantal mal fragen, wenn ich das nächste Mal eine ihrer Verkörperungen in der Straßenbahn sehe.