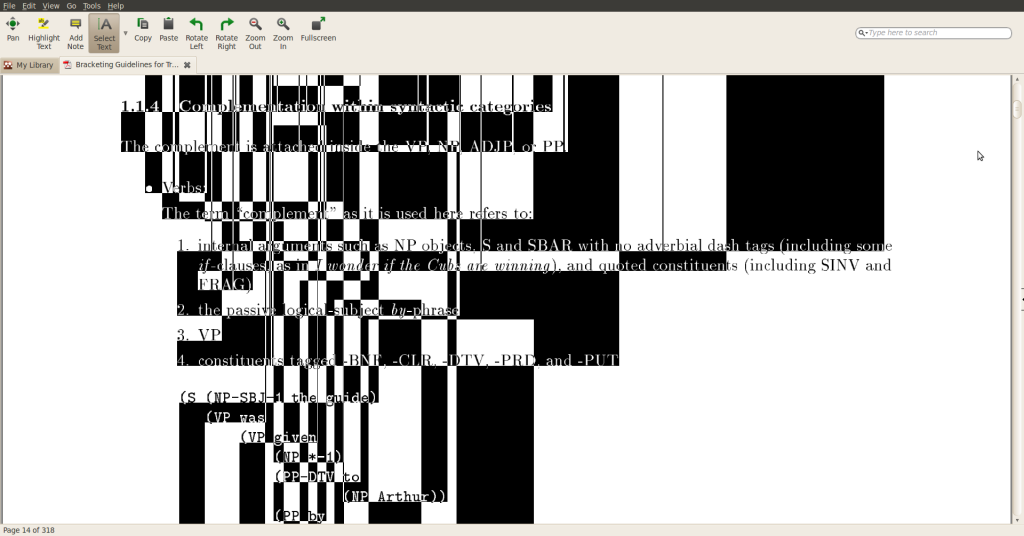Vor fünf Monaten kaufte ich mir ein iPhone 3G und erwartete, man würde mich dafür dissen. Tat man aber nicht. Was mache ich jetzt mit der sorgsam vorbereiteten Verteidigungsschrift? Einfach ablegen:
Ein so hochgezüchtetes Handy ist nur zum Angeben. Stimmt nicht. Ich hatte den starken Wunsch, Telefon und MP3-Player immer dabei haben zu können, ohne mehr als ein Gerät zu schleppen. Wenn man dann auch noch Wert darauf legt, viel Musik in akzeptabler Qualität dabeizuhaben, hat man schon nicht mehr viel Auswahl auf dem Handymarkt. Internetfähgikeit und GPS waren mir nicht wichtig, aber auch nicht zuwider. Auf die Designer-Marke hätte ich lieber verzichtet und z.B. das Android-Handy G1 genommen, aber für diesen Ausbund and Hässlichkeit war ich dann doch zu sehr Ästhet.
Niemand braucht ein Internet-Handy. Stimmt nicht. Ob es jetzt gut war, dass ich zum ersten Mal eine ganze Urlaubswoche lang jeden Tag meine E-Mails und Feeds gelesen und so manche Mail auch geschrieben habe, mag man sich streiten. Was ich indes nie mehr missen möchte, ist die Maps-Applikation. Meine Orientierungsfähigkeiten in fremdem Gelände sind nicht überdurchschnittlich und ein zoombarer Stadtplan, der in die Handfläche passt und – entscheidend! – einem zeigt, wo man sich befindet, ist ein wahrer Segen.
Das iPhone ist viel zu teuer. Stimmt nicht. Es kostet viel, ist aber jeden der ca. 750 € (Zuzahlung + zwei Jahre überdimensionierter Mobilfunkvertrag) wert. Wie bei Apple üblich, ist viel Geld und hektoliterweise Schweiß darein geflossen, dass die Bedienung einfach ist und das Ding verdammt noch mal einfach funktioniert. Und das ist unterwegs entscheidend. Zum Beispiel verbindet sich mein iPhone praktisch immer innerhalb von drei Sekunden mit jedem WLAN, das es schon kennt. Es funktioniert einfach. Kann das Ihr PC?
Auch das iPhone hat gravierende Mängel. Stimmt. Die Kamera des 3G fällt hinter die Qualitätsstandards des Restgeräts weit zurück, sie taugt überhaupt nichts (die des Nachfolgemodells 3G S soll besser sein). Will man also auf das Mitschleppen eines weiteren Geräts, einer eigenen Kamera, verzichten, muss man sich schon auf sehr mindere Schnappschüsse bei guter Beleuchtung beschränken. Der ganze Spuk mit der closed-source-Software ist natürlich auch ein gravierender Mangel – ich wusste schon beim Kauf, dass ich ominöse Tools und viel Nervenstärke würde einsetzen zu müssen, um das Gerät unter Linux mit Musik befüllen zu können. Hat aber geklappt. Völlig unverzeihlich ist, dass man ohne Jailbreak und hackichte Modifikationen auch keine Chance hat, in SMS-Nachrichten Wörter zu verwenden, die nicht im Wörterbuch der jeweils aktivierten Sprache stehen. Hat man solches schon vernommen?! Wer mich nur ein bisschen kennt, weiß, wie sehr das meinem Gebrauch von Sprache widerspricht.