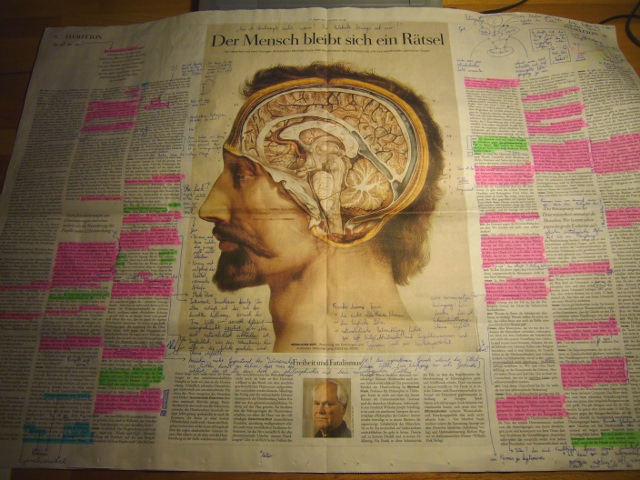Ein wiederkehrendes Thema in meinem Geistesleben ist die universelle Ausdrucksmächtigkeit der Sprache unabhängig von formalen Bedingungen.
Dazu zählt die von mir ziemlich stark verinnerlichte radikale Gegenthese zur Sapir-Whorf-Hypothese. Sie (also die Gegenthese) besagt, dass alle Inhalte, die in menschlicher Sprache ausgedrückt werden können, in jeder menschlichen Sprache ausgedrückt werden können, und zwar – modulo eventueller Erweiterung um das jeweilige Fachvokabular – gleich gut, gleich elegant, gleich verständlich, gleich schön etc. Eine Sprache zu entwickeln zähle zu den biologischen Eigenschaften des homo sapiens, keine Sprache sei für eine bestimmte Kultur „gemacht“, Wechselwirkungen zwischen Sprache und Kultur seien natürlich vorhanden, aber schwach, oberflächlich und von keiner Bedeutung für die Ausdrucksmächtigkeit der Sprache.
Unausgesprochene Grundannahme so einer These ist, dass sprachliche Äußerungen so etwas wie einen „Inhalt“ haben, der von der „Form“ isoliert werden könne. Diese Isolierung philosophisch oder gar formal-linguistisch präzise zu fassen ist ein hoch komplexes, odysseskes, wenn nicht sogar quijotäres Unterfangen, aber eine intuitive Vorstellung von so einer Trennung zwischen Form und Inhalt haben wohl die meisten Menschen.
Neben der Frage, ob alle natürlichen Sprachen (und Dialekte) gleich ausdrucksmächtig sind, kann man sich die Frage stellen, welche literarischen Varietäten einer Sprache für eine Autorin und ihre Leserinnen die gleichen Funktionen erfüllen können, spezifischer: unter welchen formalen Beschränkungen ein Text bestimmte Funktionen noch genau so gut erfüllen kann wie ohne sie. Formale Beschränkungen gibt es zuhauf: Textlänge, verständliches Schreiben, Schreiben in einem bestimmten Stil, Schreiben nur im Präsens, Unzulässigkeit des Anpassens von Flexionsendungen in Zitaten an den eigenen syntaktischen Kontext, Text muss genau sechs Wörter haben, Text muss in Palindromform sein, Text muss ein gültiges Perl-Programm und überdies ein Quine sein, Text darf kein E enthalten… man könnte sich hinstellen und sagen: So verrückten Beschränkungen ein Text auch unterworfen sein mag, eine gut genuge Autorin wird auf anderen Ebenen so geschickt sein, dass sie inhaltlich genau dasselbe rüberbringen kann wie ohne sie. In der Literatur als Kunstform, die vom Wechselspiel, der Untrennbarkeit von Form und Inhalt besonders stark lebt, natürlich eine verwegene Behauptung.
Aber Leute haben es ausprobiert, haben experimentiert, haben Literatenzirkel zum Erfinden neuer formaler Beschränkungen und Verfassen von Literatur darunter gegründet (Oulipo). Georges Perec hat auf Französisch einen Mystery-Roman ohne ein einziges E geschrieben. Dass dessen Hauptperson nicht Grégoire Clément heißt, kann man sich denken. Abgesehen von solchen Oberflächlichkeiten fragt sich die Leserin: Wie viel von der Handlung, von der Ausgestaltung ist ein Zugeständnis an die E-Beschränkung? Hätte Perec in groben Zügen denselben Roman geschrieben ohne die Beschränkung?
Abgesehen von metaliterarischen Wonnen haben formale Beschränkungen den Vorteil, dass der Autorin Entscheidungen abgenommen werden und sie sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Auf den Inhalt. Auf die Originalität. Auf die Schönheit. Im Korsett einer formalen Beschränkung kommen Autorin und Leserin dem Gefühl viel leichter viel näher, dass alles Menschenmögliche getan wurde, um einen Text so gut wie möglich zu machen.
Wie zum Beispiel die berühmteste formale Beschränkung des letzten Jahres: Nur 140 Zeichen pro Text. Der Text wird dann Tweet genannt, das Verfassen und Veröffentlichen solcher Texte im Internet twittern oder microbloggen. Die Website Twitter macht so gut wie nichts anderes, als ihren Benutzerinnen das Veröffentlichen von bis zu 140 Zeichen langen Texten zu ermöglichen und miteinander in ein gerichtetes soziales Netzwerk einzutreten, das bestimmt, wem wessen Tweets gezeigt werden. Mit diesem ultrasimplen System ist das Microbloggen in kurzer Zeit waaahnsinnig beliebt geworden.
Ich kann das mittlerweile gut verstehen. Freilich, eine klassischer Bloggerin darf beim Schreiben ganz frei entscheiden, wann sie aufhört. Aber sie muss es eben auch. Sie muss inhaltlichen Umfang, Textdichte und ihren Wunsch, eine bestimmte Anzahl von Leserinnen bis zum Ende durchhalten zu lassen, austarieren. Bei Twitter dagegen gibt es einen Zeichenzähler, der eine realistische Normleserinaufmerksamkeitsspanne simuliert. Wenn er rot und negativ wird, ist das eine klare Ansage: Jetzt ist Kürzen angesagt und ggf. Auslagerung des nächsten Gedankens in einen eigenen Tweet.
Es ist auch eine große Wohltat, dass Twitter technisch minimalistisch ist und einen nicht mit allen möglichen Zusatzfunktionen zuballert wie ein klassisches Blogsystem. Wer Zusatzfunktionen will, muss ein ganz klein wenig zur Programmiererin werden. Die Twittergemeinde schafft sich ihre Werkzeuge selbst, hier kann man Kulturevolution im Fruchtfliegentempo beobachten. Tweets kategorisieren? #Raute vor ein Wort im Text. Benutzerin verlinken? @ vor den Namen. Lange Sätze posten? Abk. verw., notf. exz. Link mit langem URL posten? Bemühe einen Adresskürzdienst. Die Adresskürzdienste, deren einzige Daseinsberechtigung ursprünglich so weit ich weiß in den Unzulänglichkeiten bestimmter E-Mail-Programme bestand, haben durch Twitter eine Blütezeit sondergleichen erfahren. Jede bessere Website rollt ihren eigenen, ich persönlich mag aber u.nu am liebsten, weil der die URLs wirklich so kurz wie technisch möglich macht, das auf wunderbar bogus-informationstheoretische Weise erklärt und einmal klanglich sehr gut zu einem meiner Tweets passte. Natürlich wandern auch andere technische Krücken sofort in das literarische Gerätearsenal, so werden Hashtags längst nicht mehr nur zur Kategorisierung verwendet, sondern auch, um nachgeschickte Einwortkommentare formal dem Genre entsprechen zu lassen, es vielleicht zu parodieren.
Gelegentlich weiß ich auch das Opulente zu schätzen, aber insgesamt bin ich ein großer Freund der reduzierten Form, das heißt in der Literatur der kurzen Form. Zugespitzt: Ja zu Gedichten, Szenen, Kurzgeschichten und Aphorismen, nein zu Gesängen, Dramen, Romanen und Essays. Dieser Appeal des Kurzen hat auch seine problematischen Seiten. Es liegt in meinem Wesen, alles zergliedern zu wollen, die Dinge einzeln abzuspeichern wie Schmetterlinge hinter Glas, zu atomisieren. Mit dem Erkennen und Spannen großer Bögen tu ich mich schwer.
Twitteratur kommt meinen so hübschen wie zweifelhaften Vorlieben daher entgegen. Gab es das eigentlich vor Twitter, dass etwas unter 141 Zeichen als eigenständiger literarischer Text gelten konnte? Es wurde versucht, aber meines Wissens nie die perfekte Form dafür gefunden. So etwas wie einen Aphorismus, ein Wortspiel (in Form eines Minimalbeispielsatzes) oder ein Ultrakurzgedicht auf eine Buchseite zu packen und sie ansonsten weiß zu lassen, wirkt prätenziös. Aphorismensammlungen wirken staubig und stickig. Listen finde ich okay, aber erst ab einer gewissen Länge, die Sofortveröffentlichung jeder neuen Schöpfung ausschließt. Blogeinträge leiden darunter, eine Überschrift haben zu wollen, die dann in den meisten Blogdesigns mehr Bildschirmfläche bedeckt als der Text – und überhaupt, bei Kurztexten wirken Überschriften eher störend, sie müssen unter Verrenkungen dazuerfunden werden.
Twitter hat das Layoutproblem gut gelöst; der jeweils neueste Tweet auf einer Mitgliedsseite erscheint in großer Serifenschrift, der Rest in normalgroßer serifenlosen. Entscheidend finde ich, wie Twitter als Literaturplattform das Prätenziositätsproblem löst: dadurch, dass es nicht nur eine Literaturplattform ist, sondern vor allem eine Kommunikations- (banale Statusmeldungen) und Nachrichtenverteilungsplattform (Schlagzeile + Link). Die Grenze zwischen banalen Tweets und denen, denen ich literarischen Wert würde zusprechen wollen, ist fließend. Die Technik macht auch da keinen Unterschied: Jeder Tweet kriegt seinen URL und seine Zeitleistenposition. Die ideale Mischung aus Normalität und Präsentierteller. Die Perlen glitzern zwischen den Kieselsteinen und das Glitzern liegt im Auge des Betrachters.