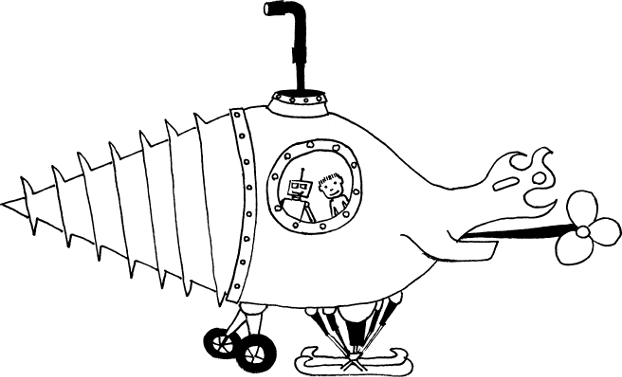Ich bin schon lange ein Fan freien Informationsflusses. Mein junges Ich war davon überzeugt, zu einem rational agent aufzuwachsen, der stets alle verfügbaren Informationen beschaffen, die irrelevanten beiseitelassen und auf Basis des Restes informierte Entscheidungen treffen würde. Ungehindert sich informieren und umgekehrt Informationen hinausposaunen zu dürfen war mir immer wichtig, und ebenso, dies auch anderen Menschen zu erlauben.
Maßnahmen, die geeignet sind, dem freien Informationsfluss Barrieren entgegenzusetzen, hatten daher stets die starke Tendenz, mir niederträchtig, nicht ganz von dieser Welt und unheimlich zu erscheinen. Solche Maßnahmen sind zum Beispiel:
- Todes-Sprüche, Todes-Videos etc. Mein oben erwähntes junges Ich stieß einmal in einem Fantasy-Rollenspiel auf einen Zettel und lies seinen Held ihn lesen. Dieser erkrankte daraufhin tödlich. Es handelte sich um einen tödlichen Zauberspruch, der noch nicht einmal durch einen Zauberer gesprochen oder mit Gesten untermalt werden, sondern nur durch das Opfer gelesen werden musste, um seine Wirkung zu entfalten. Man konnte also noch nicht einmal Kenntnis von dem Spruch erlangen, ohne zu sterben. Mein junges Ich war ehrlich gesagt etwas geschockt, dass ein Autor sich so etwas auch nur ausdenken konnte. Aber es war natürlich nur Fantasy. Von dem Horror-Film Ring, in dem ein entsprechendes Todes-Video vorkommt, fühlte sich mein junges Ich einige Jahre später entsprechend gut gegruselt und unterhalten.
- Auch Digital Rights Management (DRM) müsste eigentlich dem Bereich des Fantasy-Horrors zuzuordnen sein, ist aber leider real. Kopierschutzmaßnahmen, die versuchen, einen daran zu hindern, Informationen (in Form von Bitsequenzen z.B. auf CDs und DVDs) frei zwischen allen Teilen des eigenen Gehirns, einschließlich seiner elektronischen Erweiterungen, fließen zu lassen – nicht ganz von dieser Welt!
- Auch Geheimhaltungsvorschriften, insbesondere strafbewehrte, sind mit „schwarze Magie“ noch freundlich beschrieben. Meine Sympathie für eine Institution nimmt exponenziell ab mit der Menge an Aktivitäten, die der Institution zufolge dem Wohle der Allgemeinheit dienen und aber gleichzeitig vor der Allgemeinheit geheimgehalten werden müssen, um diesen Dienst leisten zu können. Neunzehnhundertvierundachtziger geht es nicht. Abgesehen von den oben geschilderten Todes-Sprüchen kann ich mir so gut wie gar keine Informationen vorstellen, deren allgemeine Verfügbarkeit inhärent schädlich wäre. Eher ist Geheimhaltung von Informationen bestenfalls ein zeitlich begrenzter Hack zur Linderung der Auswirkungen anderer gesellschaftlicher Missstände. Entsprechend oft nickend verfolge ich die Veröffentlichungen der Post-Privacy-Bewegung, etwa in deren Inkarnation als datenschutzkritische Spackeria.
- Die Ächtung von so genannten „Spoilern“: Weit verbreitet ist die Auffassung, man dürfe den Ausgang von Büchern, Filmen etc. nicht verraten, ohne dick und fett davor zu warnen und es möglichst einfach zu machen, über die Information hinwegzuscrollen wie über einen Todes-Spruch. Ich fand das immer befremdlich, denn für meinen eigenen Genuss von Filmen, Büchern etc. spielt es eine exzessiv geringe Rolle, ob ich schon weiß, wie es ausgeht. Aber das gehört so zu den schrulligen Tabus, an die man sich noch ganz gut anpassen kann.
- Als Freund des freien Informationsflusses mag ich natürlich auch das Konzept der Filtersouveränität und es entlockt mir relativ schnell Kopfschütteln, wenn jemand die Auffassung kommuniziert, ein Mitglied einer Teilöffentlichkeit sei dafür verantwortlich, unerwünschte Informationen aus der Wahrnehmungssphäre eines anderen Mitglieds herauszuhalten. Zum Beispiel, wenn sich auf Twitter Leute darüber aufregen, dass andere ihnen unerfreuliche Tweets in die Timeline „spülen“. Oder wenn im Jahre fucking 2013 Leute noch routinemäßig öffentliche Bekanntmachungen mit „Apologies for cross-posting“ einleiten. Ich sage, dass es mir relativ schnell Kopfschütteln entlockt, nicht, dass ich es generell ablehne, denn, wie sanczny in ihrem Aufsatz Das Postprivate ist politisch, insbesondere im Abschnitt Too Much Information, darlegt, sollte es nicht allein Verantwortung der empfangenden Partei sein, unerwünschte Kommunikation abzuwehren. ich bin daher für einen Pluralismus der Teilöffentlichkeiten, der die Filtersouveränität um Verantwortung für der jeweiligen Teilöffentlichkeit angemessenes Senden ergänzt.
- Relativ kürzlich ist meinem jetzigen, abgeklärteren Ich noch eine Kategorie von Anti-Informationsfluss-Attitüden aufgefallen, die also auch in diese Auflistung gehört: Wenn man zum Beispiel lieber nicht so genau wissen will, welche Krankheitsrisiken sich so in der eigenen DNA verbergen, oder was Mitmenschen über einen denken, ohne es einem zu sagen. Da weiß ich auch nicht: Würde ich diese Informationen, wenn ich sie hätte, in dem Maße ignorieren können, wie ich mich nicht mit ihnen beschäftigen wollte? Kann ich ihren freien Fluss also wollen?